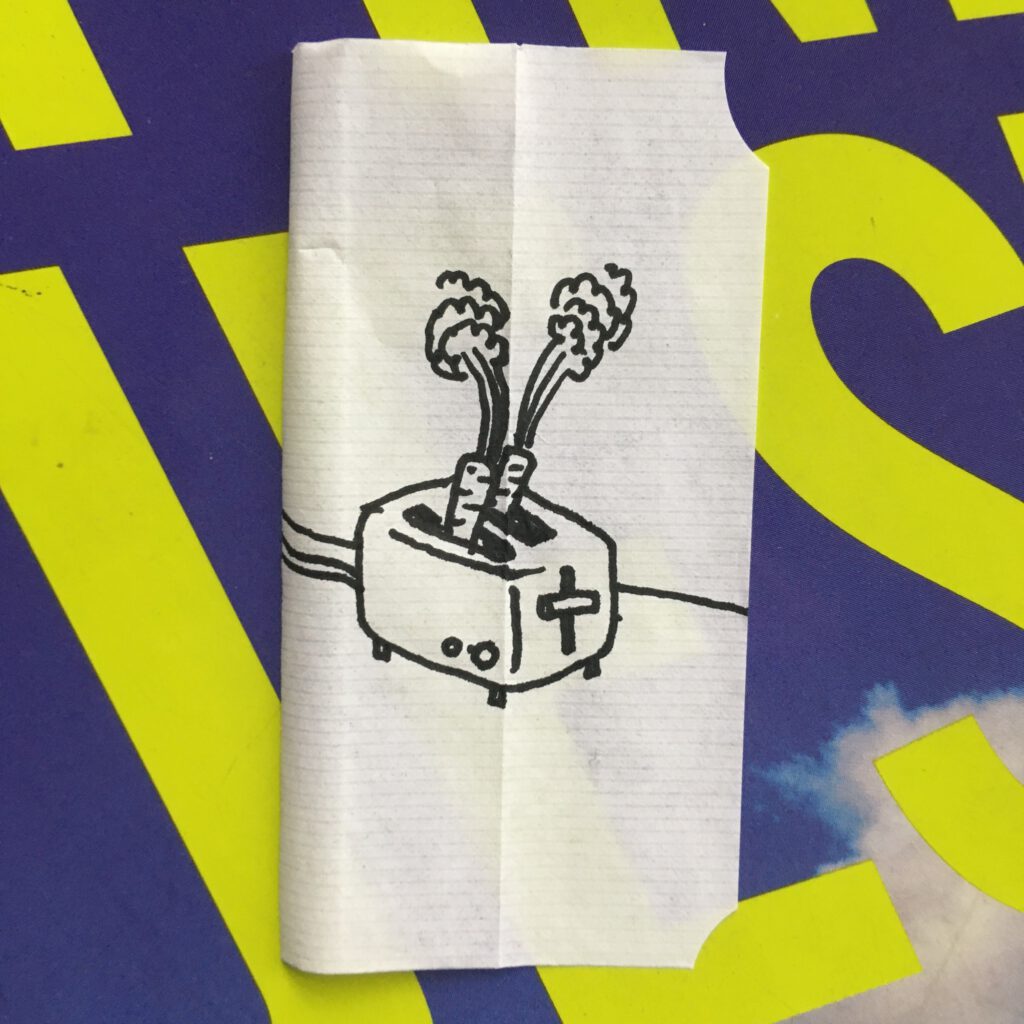1996 veröffentlichte David Foster Wallace seinen Roman Infinite Jest. Zum 25. Jubiläum verrät Patricia Nitzsche uns ihren individuellen Zugang zu Werk und Autor und nimmt einige faszinierende Einzelteile dieses literarischen Riesenpuzzles unter die Lupe. Wie treffend waren die dystopischen Prognosen von Foster Wallace? Was können wir aus der Lektüre von Infinite Jest etwa über die Authentizität des Schmerzes, die verlockenden Denkfallen der Selbstoptimierung oder die schleichende Verschiebung gesellschaftlicher und individueller „default settings“ erfahren? In diesem essayistischen Long Read erfahren wir, weshalb die (Wieder-)Entdeckung dieses Schlüsselwerks der literarischen Postmoderne gerade heute, in pandemischen Zeiten, unbedingt lohnt.
Text: Patricia Nitzsche. Illustrationen: Maika Hassan-Beik
Alle Welt redet von Orwells 1984, wenn es um die Aktualität literarischer Dystopien geht. Für mich aber ist ein anderer Roman das Buch der Stunde – nicht nur, aber ganz besonders in Zeiten der Pandemie: Infinite Jest von David Foster Wallace. Nun, was haben wir da? Zum einen eine Gesellschaft, die ihre Zeit beinahe komplett vor der Glotze verbringt und von einer Art medialem Virus bedroht wird, zum anderen eine groteske nihilistische Separatist*innengruppe, die sich genau dieses „Virus“ zunutze machen will, um das bestehende System zu bekämpfen; eine privilegierte Zwangsgemeinschaft, in der die Einzelnen nur mit viel Disziplin und ein paar synthetischen Hilfsmitteln ihren wiederholungsschleifenartigen Alltag überstehen; eine andere, prekäre Zwangsgemeinschaft bestehend aus Risikopatient*innen, die sich von Tag zu Tag hangeln und sich gegenseitig in “Tough Shit You Still Can’t Drink”-Selbsthilfegruppen Mut zusprechen (man ersetze “Drink” durch jede andere pandemiebedingt eingeschränkte Tätigkeit). Und über allem schwebt die omnipräsente (Ehr-) Furcht vor der Außenwelt, dem “Out There”, das einerseits Verlockung, andererseits aber v. a. Bedrohung bedeutet. Doch all diese inhaltlichen – und, zugegeben, etwas konstruierten – Bezüge zu unserer momentanen Realität mal beiseite gelassen, ist Infinite Jest einfach ein sehr, sehr dickes Buch, mit dem sich sehr, sehr viel Zeit zu Hause totschlagen lässt. Der nächste Lockdown kommt bestimmt!
In diesem Text soll es in Wirklichkeit aber gar nicht so sehr um Pandemien oder andere gesellschaftliche Katastrophen gehen, sondern um schwarze Löcher und unendliche Weiten zwischen Nullen und Einsen. Und ein bisschen auch um Karotten.
– I –
Heute ist Sonntag, der 8. November, Interdependence Day. Ich sitze auf meinem Bett, habe soeben das “big book” nach einem Dreivierteljahr zugeschlagen und lasse das, was ich in meiner zweiten Runde des unendlichen Spaßes gesehen, gehört und empfunden habe, noch einmal Revue passieren.
Ich habe gelernt, dass Drogenabhängige, die kriminell werden müssen, um ihre Abhängigkeit zu finanzieren, selten zu Gewaltverbrechen neigen. Ich habe gelernt, wo 90 Prozent der amerikanischen Oberschicht ihren Safe und das Tafelsilber aufbewahren.
Ich habe erfahren, dass Kanadier*innen ein Bein heben, um zu furzen, und Deutsche den Ton senken, wenn sie Eindruck machen oder bedrohlich wirken wollen. Dass man Unterschichtkinder daran erkennen kann, dass sie zuerst den Kopf und dann die Arme ins Shirt stecken statt andersherum oder daran, dass sie ihre Füße in folgender Reihenfolge bekleiden: Socke, Schuh, Socke, Schuh.
Ich habe mich dabei ertappt, wie ich mir als lesende Person ganz automatisch die Physiognomie der handelnden Charaktere vorstelle, nämlich einigermaßen „normal“. Nun ja, dieser Zahn wird einem ziemlich schnell gezogen. Mal abgesehen davon, dass in Infinite Jest sehr viel gefurzt, geschwitzt und gekotzt wird – es wimmelt nur so von körperlichen Abnormitäten und Deformationen, die teilweise so bizarr anmuten, dass sie schon wieder glaubhaft sind.
Ich habe recherchiert, welche psychoanalytische Bedeutung hinter wiederkehrenden Alpträumen von ausfallenden oder zersplitternden Zähnen steckt. Bei der Recherche zur Alptraumdeutung von Gesichtern im Boden, atmenden Zimmerdecken oder Uhrzeigern, die auf 18:30 Uhr eingefroren sind, war ich leider weniger erfolgreich.
Ich habe mein Wissensspektrum möglicher psychischer Störungsbilder und Tics enorm erweitert, ganz zu schweigen von der Palette chemisch-pharmazeutischer Zusammensetzungen und ihrer Wirkung.
Ich habe angefangen, die verschiedenen handelnden oder auch nur erwähnten Personen zu zählen, die einen einsilbigen Nachnamen tragen – es sind: 85 (wenn man die siamesischen Zwillinge Caryn und Sharyn Vaughn als zwei Personen zählt).
Ich habe mir sagen lassen, dass geborene Bürokrat*innen in der Regel von niedriger Statur sind. Und dass sich in der Mikrowelle ziemlich gut pochierte Eier zubereiten lassen.
Ich habe mich gefragt, wie viel wohl von einem Kopf übrig bleiben kann, der von seinem Besitzer in Selbsttötungsabsicht in eine präparierte Mikrowelle gesteckt wurde. Darauf folgte irgendwann die Frage, ob diese Methode wohl dem Suizid per Müllschlucker vorzuziehen wäre.
Ich muss zugeben, dass ich nach dem Lesen einiger Passagen Bilder im Kopf hatte, die ich lieber nicht im Kopf gehabt hätte. Dafür habe ich beim Lesen anderer Passagen eine Art Ekstase erlebt, die ich sonst bislang höchstens von Live-Konzerten kannte – was sich ziemlich sicher auf David Foster Wallaces Virtuosität in Sachen sprachliches Tempo und Rhythmus zurückführen lässt.
Ich habe festgestellt, welchen Horror Raquel Welchs Gesicht und Linda McCartneys Stimme auslösen können (und, mit Abstrichen: Winston Churchills Kopf).
Ich habe versucht, alle Bezüge zu Shakespeares Hamlet zusammenzutragen (Hamlet überhaupt erst mal gelesen) – es sind: einige.
Und auch wenn ich keinen Beweis dafür habe, bin ich zu der festen Überzeugung gelangt, dass sich hinter den ersten beiden Worten und dem letzten Wort des Romans eine geheime Botschaft versteckt.
Wem dieser Einstieg irgendwie bekannt vorkommt, ist vermutlich schon mal mit einem anderen Text von David Foster Wallace in Berührung gekommen, nämlich dem Essay A Supposedly Fun Thing I’ll Never Do Again. Darin fasst David Foster Wallace am Anfang seine Eindrücke, die er während einer Woche an Bord eines Luxus-Kreuzfahrtschiffes teilnehmend beobachtet hat, in ganz ähnlicher Form zusammen. Einer kleinen internen Umfrage zufolge gehört dieser Text jedenfalls zu den bekannteren aus David Foster Wallaces Gesamtwerk. Doch davon mal abgesehen, ist der Einstieg mit A Supposedly Fun Thing I’ll Never Do Again keineswegs willkürlich gewählt. Vielmehr verbindet beide Texte mehr, als es auf den ersten Blick scheint: Anders als es eine Unternehmung wie eine gesponserte Urlaubswoche auf einem Luxusdampfer oder ein Titel wie Infinite Jest bzw. Unendlicher Spaß annehmen lassen, sind die Texte von tiefer Melancholie geprägt (was allerdings nicht heißt, dass der Spaß zu kurz kommen würde). Der Kreuzfahrt-Essay bereitet gewissermaßen vor, was im kurze Zeit später veröffentlichten Roman in größerem Maßstab verhandelt wird, nämlich in erster Linie “death/despair/pampering/insatiability issues” (ASUPFTH: 821). David Foster Wallace beschäftigt sich hier wie dort mit der Frage, was genau den Reiz daran ausmacht, zu Tode amüsiert (gepampert/unterhalten) zu werden.
Ein anderer DFW-Text, der einigen bekannt sein könnte, ist This Is Water, eine verschriftlichte Rede, die David Foster Wallace drei Jahre vor seinem Tod vor College-Absolvent*innen gehalten hat und die posthum in Buchform veröffentlicht worden ist. Das schmale Büchlein eignet sich geradezu ideal, um in der Buchhandlung des Vertrauens aus dem „Alltagsphilosophie“-Regal gezogen und als persönlich-unpersönliches Gastgeschenk zu einer Geburtstagsparty mitgebracht zu werden, wodurch die schenkende Person ganz beiläufig distinguierten Geschmack und Tiefgründigkeit beweisen kann. Mit dem Universalgenie David Foster Wallace macht man schließlich nichts falsch. Losgelöst vom Gesamtkontext des DFW-Werks bekommt der Text allerdings schnell einen kitschig-beliebigen Touch im Stile der Self-Help-Literatur – was David Foster Wallace nun wirklich völlig unrecht tut. Nur allzu gern würde ich allen, die This Is Water als seichte Alltagsmoral wahrnehmen, die ursprüngliche Version der titelgebenden Fischparabel unter die Nase halten: In Infinite Jest wird sie nach einem Treffen der Alcoholics Anonymous (AA) von einem trockenen, aber ansonsten so ziemlich jedes männliche Biker-Klischee erfüllenden Typen namens Robert F. alias Bob Death in Form eines Witzes zum Besten gegeben – in direkter Anknüpfung an einen üblen Herrenwitz, der mit Fischgeruch zu tun hat…
Ich bringe This Is Water hier ebenfalls gleich am Anfang ins Spiel, weil auch dieser Text viel mit Infinite Jest gemeinsam hat. This Is Water ist gewissermaßen das Kondensat dessen, was in Infinite Jest auf viel subtilere bzw. literarische Weise verhandelt wird. Es geht hier wie dort um unsere Wahrnehmung und unseren Umgang mit dem alltäglichen Dasein, das in erster Linie mal eins ist, nämlich: wahnsinnig unsexy.
– II –
Ein Hinweis vorab: Wer vorhat, Infinite Jest zu lesen, für gewöhnlich aber Romane mit linearer Erzählstruktur bevorzugt, wird von dem mehr als 1 kg schweren Brocken ziemlich sicher erst mal abgeschreckt sein. Der Plot (wenn man davon im klassischen Sinne überhaupt sprechen kann) ist so ziemlich das absolute Gegenteil von linear: Er springt in Ort, Zeit, handelnden Personen und auch Sprachstil und Erzählverhalten hin und her – ein schier unfassbares Durcheinander mit zig Querbezügen, die noch mal potenziert werden durch die knapp 400 Fußnoten mit teilweise eigenen Fußnoten. Und ja, so leid es mir tut, man sollte unbedingt alles komplett lesen. Willkommen in der “Tough Shit You Still Can’t Skip”-Selbsthilfegruppe!
So schwierig es ist, eine Storyline auszumachen, so schwierig ist es auch, Infinite Jest irgendeinem Genre zuzuordnen: Meta-/Post-/Post-Post-Modernismus? Check. Gesellschaftssatire? Doppelcheck. Tragikomödie? Unbedingt. Enzyklopädischer Roman? Ita est. “Hysterical Realism”? Keine Ahnung, was Wikipedia damit genau meint, aber klingt passend. Man könnte stundenlang so weitermachen und würde dem Ganzen doch nicht gerecht. Parallelen zur klassischen Hamlet-Tragödie wurden schon erwähnt; ein starker parodistischer Einschlag à la Monty Pythons The Funniest Joke in The World sind nicht zu übersehen; der ominöse, in Umlauf befindliche Unterhaltungsfilm mit dem vermuteten Titel Infinite Jest funktioniert als typischer Hitchcock’scher “MacGuffin” und man fühlt sich an vielen Stellen unweigerlich an popkulturelle Klassiker der 1990er-Jahre, von The Big Lebowski über Pulp Fiction hin zu Trainspotting erinnert. Selbst an fantastischen Elementen wie schwebenden Objekten, Gurus und Geistern mangelt es nicht.
Was in der Aufzählung noch fehlt, ist das Genre Utopische bzw. Dystopische Literatur, denn die Handlung spielt, vom Erscheinungsdatum 1996 aus betrachtet, mehr als zehn Jahre im Voraus – genau genommen im “Year of the Depend Adult Undergarment” (Y. D. A. U.), was ungefähr 2009 entsprechen dürfte.
Happiness Is A Warm Gun
Hier ein zwangsläufig unzulänglicher Versuch, die Handlung von Infinite Jest etwas zu entknoten: Die USA haben sich mit Kanada und Mexiko zur sogenannten O. N. A. N. zusammengeschlossen. Dessen Präsident heißt Johnny Gentle, der vorher als professioneller Schnulzensänger tätig war und, freundlich ausgedrückt, “not exactly the most candent star in the intellectual Orion” ist. In Ermangelung nennenswerter äußerer Feinde besinnt sich die O. N. A. N. darauf, im eigenen Land aufzuräumen – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes: Gentles Clean Party hat sich der sogenannten Annularfusion verschrieben, einem komplexen physikalischen Verfahren der Abfallbeseitigung, das allerdings so effizient ist, dass es jegliche Voraussetzung für Leben auf dem umliegenden Gebiet (in etwa Québec) gleich mit beseitigt. Dies wiederum ruft kanadische Separatist*innengruppen wie die “Assassins des Fauteuils Rollents” (A. F. R.) auf den Plan, die um jeden Preis die Abspaltung Québecs von O. N. A. N. erwirken wollen. Mittel der Wahl ist ein Unterhaltungsfilm, dessen Inhalt so unterhaltsam ist, dass die zuschauende Person schon beim ersten Blick zu nichts anderem mehr in der Lage ist, als mit rotierenden Hypnosespiralen in den Augen auf ihrem Hintern zu sitzen und weiterzuschauen. (Gerüchteweise sterben die Betroffenen mit einem Lächeln auf den Lippen.) Der Film, unter Eingeweihten „Samisdat“ genannt, hat bereits erste Opfer gefordert und neben der A. F. R. hat auch der US-Geheimdienst legitimes Interesse daran, in den Besitz der Mastercopy zu gelangen. Deren Verbleib ist allerdings ebenso unbekannt wie der genaue Inhalt des Films und wird im Umfeld der beiden Haupthandlungsorte in Boston vermutet: Auf der einen Seite ist da die “Enfield Tennis Academy” (E. T. A.) mit dem 17-jährigen Harold (“Hal”) Incandenza, jüngster Sohn des Annularfusions-Pioniers, E. T. A.-Gründers und vermeintlichen „Samisdat“-Schöpfers James O. Incandenza, der vor vier bis fünf Jahren Suizid begangen hat. Hal verfügt über enzyklopädisches Wissen und ist ein talentierter Tennisspieler mit Aussicht auf die “Show”, also Erfolg und Ruhm im Profisport. Nur wenige Vertraute wissen, dass Hal regelmäßig Cannabis raucht, und noch weniger ahnen, dass das v. a. etwas mit der tiefen emotionalen Leere zu tun hat, die Hal seit Kindheitstagen verspürt. Derweil zerbricht sich Donald (“Don”) Gately, früherer Polytoxikomaniker und Krimineller, mittlerweile Teil der Belegschaft der Entzugsklinik “Ennet House Drug and Recovery House”, seinen riesigen, quadratischen Schädel darüber, wie man zu seinem eigenen Gott finden kann und ob die klischeehaften Durchhalteparolen der AA-Veteran*innen möglicherweise tatsächlich wahr sein könnten.
– III –
Doch bevor wir uns der eigentlichen Haupthandlung zuwenden, noch einmal kurz zurück zur Genrefrage: Es gibt durchaus Grund zur Annahme, dass auch Fans von klassischer Science-Fiction-Literatur bei Infinite Jest auf ihre Kosten kämen. Schließlich spielt die Handlung wie erwähnt in der (wenn auch nahen, so doch) Zukunft und diese hat ein paar interessante technologische Innovationen zu bieten: zum einen die Annularfusion mit ihren Nebenwirkungen quasi-apokalyptischen Ausmaßes. Zum anderen werden immer wieder neuartige Entwicklungen im Bereich der Kommunikations- und Unterhaltungsmedien in die Handlung eingeflochten.
Nihilistisches Bingewatching
So wird etwa ausführlich beschrieben, aus welchen Gründen sich die Videotelefonie im Boston des Y. D. A. U. nicht hat durchsetzen können (nennen wir es mal „hysterische Eitelkeits-Paranoia“). Das Kabelfernsehen hingegen ist längst durch eine neuartige digitale Technologie abgelöst worden, die quasi mit dem Unternehmen “InterLace TelEntertainment” gleichgesetzt wird. Dessen Erfolgskonzept besteht darin, die notorisch gelangweilten Durchschnittszuschauer*innen vermeintlich aus der Passivität herauszuholen und “[t]otal freedom, privacy, choice” (INFJ: 620) bei der Programmauswahl zu garantieren. Überhaupt gehört die digitale Vernetzung längst zur standardmäßigen Infrastruktur: “Half of all metro Bostonians now work at home via some digital link. 50% of all public education disseminated through accredited encoded pulses, absorb-ableat home on couches. […] One-third of those 50% of metro Bostonians who still leave home to work could work at home if they wished. And (get this) 94% of all O. N. A. N.ite paid entertainment now absorbed at home: pulses, storage cartridges, displays, domestic decor – an entertainment-market of sofas and eyes. […] But so very much private watching of customized screens behind drawn curtains in the dreamy familiarity of home. A floating no-space world of personal spectation.” (Ebd.)
Das ist schon eine ziemlich treffende Beschreibung dessen, was unseren Alltag heute, ein Vierteljahrhundert nach Erscheinen von Infinite Jest, ausmacht. Nur dass die „Glotze“ mittlerweile nicht mehr nur ein rechteckiges Möbelstück oder Display ist, auf das wir von unserem Sofa aus starren, sondern ein mobiles Endgerät, das wir überall und jederzeit aus der Tasche ziehen und wahlweise zum Wohnzimmer, Büro, Trainings-, Unterrichtsraum etc. umfunktionieren können. Damit wird die (Suggestion von) Wahlfreiheit quasi ins Unendliche gesteigert – was gleichermaßen für die Sogwirkung gilt. Man könnte auch einen anderen Begriff für diesen Sog verwenden, nämlich: Abhängigkeit. Und die spielt in Infinite Jest in ihrer extremen Form, der Sucht, eine zentrale und vielseitige Rolle.
Aber bleiben wir noch kurz bei der digitalen Vernetzung. Wie bei so ziemlich allen technologiebasierten gesellschaftlichen Innovationen zuvor, wird die digitale Revolution heute nicht mehr nur als ultimative Antwort auf soziale Probleme aller Art angesehen, sondern treten immer stärker ihre Schattenseiten und die durch sie neu geschaffenen sozialen Probleme in den Vordergrund. Inzwischen ist uns bewusst, dass das Internet eben nicht nur ein Medium ist, das die schnelle Verbreitung von Informationen in die letzte Ecke der Welt befördert, sondern ebenso eines, das sich besonders gut dazu eignet, Informationen zu verzerren oder zu manipulieren; wir haben erkannt, dass es die Vernetzung und Kommunikation von Menschen auf globaler Ebene befördert, gleichermaßen aber gefährliche Filterblasen und Echokammern erzeugt; und während wir auf der einen Seite die unfassbare Vielfalt an Kunst-, Kultur- und Unterhaltungsformen – kurz: an Kreativität – zu schätzen wissen, die im Prä-Internetzeitalter schlichtweg undenkbar gewesen ist, müssen wir auf der anderen Seite feststellen, dass damit eben auch eine neue Dimension von Abhängigkeit einhergeht.
Spätestens mit der Corona-Pandemie ist diese unsere Abhängigkeit von einer stabilen Internetverbindung mehr als deutlich zutage getreten bzw. hat sich durch sie sogar noch verstärkt. Nichts geht mehr ohne das Internet in seiner mobilen Highspeed-Variante; es gehört so selbstverständlich zu unserer physischen und mentalen Infrastruktur wie der Straßenverkehr oder die Gesundheitsversorgung. Schon unter Normalbedingungen würde ein Zusammenbruch der Hauptserver gefühlt einem Super-GAU gleichkommen. Man mag sich gar nicht vorstellen, was in einer Ausnahmesituation wie einem nationalen Lockdown passieren würde …
Das zeigt, dass Abhängigkeit immer auch gleichbedeutend mit Vulnerabilität ist. Und so liegt die Idee nahe, dass auch unsere Abhängigkeit von einem ultimativen Kommunikations- und Unterhaltungsmedium ganz leicht gegen uns verwendet werden könnte, als terroristische Waffe.
In Infinite Jest stellt der „Samisdat“ exakt solch eine Waffe dar: Sie zielt auf den vermeintlich wundesten Punkt der US-amerikanischen (bzw. westlichen, postmodernen) Gesellschaft, nämlich ihr obsessives Verlangen – ihre Sucht – nach Unterhaltung. Dieses Verlangen greift der „Samisdat“ auf und steigert es ins tödliche Extrem. Die Unterhaltung ist so unterhaltsam, dass sie sämtliche Aufmerksamkeit absorbiert und nach und nach alle übrigen menschlichen Bedürfnisse absterben lässt, bis zu dem Punkt, an dem der gesamte Organismus zusammenbricht. Aus dem “Fun” wird ein “Too Much Fun”.
Wobei man den vermeintlichen Spaßfaktor an dieser Stelle sofort relativieren muss. Wenn man David Foster Wallaces Gesamtwerk etwas näher kennenlernt, stellt man schnell fest, dass Abhängigkeit und Sucht darin selten aus übertriebener „Lebenslust“ oder „Spaß an der Freude“ entstehen. In David Foster Wallaces Texten konsumieren die Protagonist*innen die Droge ihrer Wahl (ob nun Unterhaltung oder Crack) seltener aus dem Verlangen, eine positive Empfindung noch zu verstärken, sondern sehr viel häufiger, um negative Empfindungen wie die eigene Unzulänglichkeit, innere Leere, Langeweile oder pure Verzweiflung für eine Weile vergessen oder wenigstens erträglich zu machen. Sie betrinken sich auf einer Party nicht, um das eigene Spaßlevel zu erhöhen, sondern um sich den anderen Partygästen attraktiver, selbstbewusster oder geistreicher zu präsentieren, als sie es im nüchternen Zustand sind (oder glauben zu sein); sie sitzen nicht stundenlang vor der Glotze, um Leuten bei deren Alltagsverrichtungen zuzuschauen, die ihren eigenen gleichen, sondern weil sie sich mit Leuten identifizieren wollen, die ein vermeintlich viel aufregenderes Leben führen als sie selbst. Und sie buchen eine Reise auf einem Kreuzfahrtschiff der Superlative nicht, weil diese eine Woche “Managed Fun” (ASUPFTH: 817f.) den Rest des Jahres in Sachen Wohlfühlfaktor noch toppen soll, sondern weil die Aussicht auf diese eine Woche sie ihren anstrengenden bis verhassten (Arbeits-)Alltag überhaupt durchstehen lässt. D. h., die Sucht nach Unterhaltung und Spaß ist in Wirklichkeit nichts anderes als eine Sucht nach Ablenkung/Zerstreuung/Sedierung.
Damit kommen wir zum entscheidenden Unterschied zwischen fiktivem „Samisdat“ und realem Streamingdienst & Co.: (1) Die Totalbefriedigung des Verlangens in Form des tödlichen Glotz-Rauschs ist für sich genommen natürlich völlig unökonomisch. Der „Samisdat“ ist insofern vergleichbar mit Drogendealer*innen, die ihren Kund*innen beim ersten Deal sofort eine tödliche Überdosis verkaufen – kein besonders geschäftsförderndes Vorgehen. Demgegenüber besteht der Erfolg und Appeal des mobilen Highspeed-Internet gerade darin, dass es ihm gelingt, seine User*innen so lange wie möglich mit immer neu(artig)em Stoff zu versorgen und so die Abhängigkeit lebendig zu halten und immer weiter zu steigern. Es geht also um die Ausdehnung und Ausdifferenzierung der Bedürfnispalette statt ihrer Totalbefriedigung.
(2) Mit der passiven Ein-Weg-Unterhaltung im Sinne des „Samisdat“ stößt man dabei schnell an Grenzen, die, wie wir aus heutiger Sicht wissen, längst gesprengt worden sind. In der fiktiven Entwicklungsgeschichte von InterLace ist bereits die Erkenntnis angelegt, dass sich passive Unterhaltung früher oder später abnutzt. Egal, wie viele Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung stehen (wie viele Filme, Serien usw. jährlich auf den Markt geworfen werden): Für die gewöhnlichen Bingewatcher*innen wiederholt sich irgendwann einfach doch alles auf die eine oder andere Art. Allerdings wird diese Erkenntnis in Infinite Jest noch nicht konsequent zu Ende gedacht, denn auch mit InterLace bleibt die Aktivität der Konsument*innen immer noch auf den ein- und umschaltenden Daumen beschränkt. Infinite Jest verhandelt gewissermaßen die Ausläufer der Generation X, die noch daran gewöhnt ist zu konsumieren, was ihr serviert wird. Die Millennials und ihre Nachfolger*innen geben sich damit längst nicht mehr zufrieden.
Halten wir also noch einmal fest, dass der „Samisdat“ für ein allgemeines Bedürfnis nach Alltagsflucht steht, welches er überbefriedigt; bei dieser Form der Unterhaltungssucht geht es darum, dem inneren schwarzen Loch zu begegnen und die Stimme, die einem ständig die Sinnlosigkeit des eigenen Daseins einflüstert, wenigstens kurz zum Verstummen zu bringen. Allerdings bleibt Infinite Jest dabei noch auf der Stufe der Ein-Weg-Unterhaltung stehen – eine in ökonomischer Hinsicht ziemlich unnötige Beschränkung. Was David Foster Wallace acht Jahre vor der Gründung der ersten Social-Media-Plattform zumindest in technologiephilosophischer Hinsicht noch unterschätzt hat, ist das enorme (Sucht-) Potenzial, das in einem anderen Bedürfnis steckt, nämlich jenem nach Resonanz. Warum sollte man sich darauf beschränken, nur zwischen dem auszuwählen, was stattfindet, wenn einem die sozialen Medien die Möglichkeit bieten, permanent selbst stattzufinden? Warum sollte man sich nur darum bemühen, die eigene Sinnlosigkeit zu verdrängen, wenn man die Möglichkeit hat, der Sinnlosigkeit etwas Sinnhaftes entgegenzusetzen? (Denn irgendeinen Sinn wird das, was man in den Social-Media-Kanälen so treibt, schließlich haben, sonst würden andere wohl kaum darauf reagieren, oder? Oder?!)
Jedenfalls spricht vieles dafür, dass sich das mobile Highspeed-Internet gerade dadurch zur ultimativen Aufmerksamkeitsabsorptionsdroge entwickeln konnte, dass es nicht nur das Bedürfnis nach dem Sehen, nach passiver Ablenkung/Zerstreuung/Sedierung bedient, sondern mindestens (!) in gleichem Maße das Bedürfnis nach dem Gesehen-Werden, nach Resonanz/Anerkennung/Bestätigung. Im digitalen Showbusiness 2.0 a. k. a. Social Media sind aus Konsument*innen längst Produzent*innen geworden, die fleißig damit beschäftigt sind, im Sekundentakt neuen Content zu liefern. Dabei sind die Mittel der Wahl recht breit gestreut: So kann man sich auf Twitter öffentlich in die Diskussion um die nachhaltigste und am besten aufschäumbare Milchalternative einbringen und zeitgleich die Mitglieder der eigenen Kittylove-Whatsapp-Gruppe zu Folterfantasien an vermeintlichen Katzenmörder*innen aufstacheln.
Das mobile Highspeed-Internet hat es geschafft, in alle Poren des privaten und öffentlichen Lebens einzusickern und die Bedürfnisproduktion nonstop am Laufen zu halten. Noch mehr Follower! Noch mehr Likes/Klicks/Kommentare! Noch mehr Aufmerksamkeit! Damit steht es inzwischen auf einer Stufe mit dem Kapitalismus, der seit Jahrzehnten recht erfolgreich damit beschäftigt ist, noch in den allerletzten weißen, d. h. nicht-kommerziellen Fleck auf der Weltkarte sein Fähnchen zu stecken.
Kleiner Exkurs zum schlimmen A-Wort
Zur zeitlichen Einordnung: Infinite Jest ist Mitte der 1990er-Jahre erschienen, der Hochzeit der großen Markenkonzerne also, die die kanadische Journalistin und Aktivistin Naomi Klein etwas später in ihrem wegweisenden Buch No Logo analysiert hat. Es ist der Beginn einer Phase des Kapitalismus, in der die Werbestrategien der Markenkonzerne nicht länger darauf ausgelegt sind, ein Produkt zu verkaufen, sondern einen kompletten Lifestyle. Die Zielgruppe wird nicht mehr länger als Teil einer großen anonymen Konsument*innenmasse angesprochen, sondern als Individuen mit individualistischen Bedürfnissen, die sich mit der Markenbotschaft des Produkts möglichst 100-prozentig identifizieren sollen. In dieser Zeit wird der Grundstein für das gelegt, was aus heutiger Sicht fast selbstverständlich erscheint: Werbung und Konsum sind dauerpräsent, ein 24/7-Grundrauschen, Teil des kollektiven mentalen Default Settings (dazu mehr in Kapitel IV).
In Infinite Jest wird diese Totalkommerzialisierung u. a. durch die von Unternehmen gesponserten Jahreszahlen repräsentiert. So gingen dem “Year of the Depend Adult Undergarment” etwa das “Year of the Whopper” oder das “Year of the Yushityu 2007 Mimetic-Resolution-Cartridge-View-Motherboard-Easy-To-Install-Upgrade For Infernatron/Inter-Lace TP Systems For Home, Office, Or Mobile (sic)” (sic) voran. Verglichen mit den heutigen Möglichkeiten, die sich durch die sozialen Medien ergeben haben, wirkt das fast schon niedlich-naiv, weil sehr offensichtlich und greifbar. Facebook, Instagram, YouTube & Co. lassen demgegenüber den lang gehegten Traum der Werbeindustrie endlich wahr werden: Werbung so individualisiert wie möglich und so unbemerkt wie möglich unter die Leute zu bringen.
Ganz besonders begehrt sind dabei Werbeträger*innen, die sich durch eine bestimmte Eigenschaft auszeichnen, und die heißt nicht etwa Glamour und Starruhm, sondern Authentizität. Viel besser noch als von Stars und Sternchen lassen sich Produkte von „ganz normalen Menschen wie du und ich“ verkaufen, die „sich nicht verstellen“ und etwas nur dann tun, wenn sie „wirklich voll und ganz dahinter stehen“. Je authentischer, d. h. unkalkulierter die Empfehlung in der Insta-Story herüberkommt, dieses oder jenes Produkt unbedingt mal auszuprobieren, #lifechangingexperience, desto höher die Followerzahl und desto lukrativer die Werbeverträge. Je authentischer, d. h. ungeschönter die Darstellung des Lebenswegs erscheint, der die Person zu der gemacht hat, die sie heute ist und der sie quasi dazu prädestiniert, anderen den Weg aus ihrem Leben voller Selbsthass, Scham und Unvermögen zu weisen, #becomethebestpossibleself, desto höher die Einnahmen ihrer Life-Coaching-Seminare.
Dieser Authentizitäts- oder auch „Street Credibility“-Verkaufsfaktor ist natürlich keineswegs neu – man denke nur an Che-Gue-Vara-T-Shirts, Holzfällerhemden oder Jeans mit desto höher die Followerzahl und desto lukrativer die Werbeverträge. Löchern, die schon zur Erscheinungszeit von Infinite Jest im Fast-Fashion-Shop des Vertrauens auf der Stange gehangen haben dürften. Vielmehr liegt die Dynamik und Anpassungsfähigkeit des Kapitalismus seit jeher in seinem Spannungsverhältnis zur Authentizität. Einerseits definiert sich Authentizität, verstanden als Sich-nicht-Verstellen, Seinen-eigenen-Prinzipien-Folgen, Ohne-Kalkül-Handeln stets in Abgrenzung zum kapitalistischen Prinzips des Sich-Verkaufens, der Permanent-Performance, andererseits profitiert der Kapitalismus in ganz besonderem Maße genau von diesem Abgrenzungsprozess, weil es ihm ermöglicht, immer wieder aufs Neue Anti-Kommerz-Inseln zu erobern. Paradox ist das Verhältnis auch deshalb, weil es an sich unmöglich ist, Authentizität zu produzieren – es würde ihrer Wesensart als etwas Natürliches, Unvermitteltes widersprechen. Andererseits hat sich gerade diese Produktion von Authentizität in den letzten Jahren zu einem extrem lukrativen Markt entwickelt. Wie man an der blühenden Achtsamkeits-/Self-Help-/Glücks-Industrie erkennen kann, wendet das postmoderne Individuum einen nicht unerheblichen Teil seiner Zeit und seines Geldes dafür auf, zu seinem vermeintlichen „inneren Kern“ vorzudringen, endlich „auf seine innere Stimme zu hören“ und „ganz im Hier und Jetzt zu leben“. Ja, und falls sich herausstellt, dass ihm Kern, Stimme und Moment gar nicht so recht gefallen, gibt es seitens der ausgewiesenen Expert*innen genug Mittelchen und Wege, mit denen sich das Ganze zweckoptimieren lässt.
Zuhören und Gehört-Werden
Die Frage indes, wie viel Authentizität in einer postmodernen, komplett durchkommerzialisierten Gesellschaft überhaupt möglich ist, zieht sich wie ein roter Faden durch David Foster Wallaces Werk. In seinen Essays setzt er sich immer wieder mit den Folgen einer allgemein zu beobachtenden ironisch-distanzierten Grundhaltung auseinander, die durch Werbebotschaften, hippe Sitcom-Charaktere etc. wenn nicht geschaffen, so doch mindestens verstärkt wird. Sie ist für ihn das Gegenteil von Aufrichtigkeit und echter Empathie, insofern als sie einem kein großes Risiko abverlangt. Nicht das Risiko, auf die eigene Verletzlichkeit zu stoßen, wenn man den Dingen wirklich auf den Grund geht statt sie nur aus sicherer Ferne zu kommentieren und auch nicht das Risiko, sich wirklich angegriffen zu fühlen, wenn man für seine Äußerungen kritisiert wird – schließlich hat man es ja nur ironisch gemeint.
In David Foster Wallaces fiktionalen Texten sind die Protagonist*innen auf die eine oder andere Art permanent mit sich selbst und/oder der Frage beschäftigt, wie sie ein bestimmtes Bild von sich bei ihrem Gegenüber erzeugen können. Dabei ist ihnen meist nicht bewusst, dass ihr Gegenüber mit genau derselben Frage beschäftigt ist, was dazu führt, dass echte Kommunikation kaum stattfinden kann.
Auch in Infinite Jest ist das Kommunikationsproblem ein dauerpräsentes. Entweder versuchen die Protagonist*innen zu sprechen, bringen aber kein Wort heraus oder die Worte dringen bei ihrem Gegenüber einfach nicht durch. Oder sie sprechen im wahrsten Sinne nicht dieselbe Sprache, was mehrfach zu tödlichen Missverständnissen führt. Meistens aber geben sie vor, ihrem Gegenüber zuzuhören, sind aber aus verschiedenen Gründen – intellektuell, aufgrund innerer organischer Vorgänge o. ä. – nicht in der Lage, dem Gesprochenen zu folgen. Und so lebt der Roman gewissermaßen von Dialogen, in denen die Protagonist*innen in irgendeiner Weise aneinander vorbei- oder auch nebeneinanderher reden. Die große Kunst besteht dabei darin, dass David Foster Wallace die Szenen amüsant und grotesk gestaltet, die handelnden Personen aber niemals der Lächerlichkeit preisgibt.
Im Gegensatz zu vielen Autor*innen seiner Generation geht es David Foster Wallace nie um reine Effekthascherei. Wenn man sich auf seine Texte wirklich einlässt, bemerkt man schnell, dass er an seinen Protagonist*innen und deren Entwicklung aufrichtig interessiert ist. Jedenfalls hat noch die nebensächlichste Figur in Infinite Jest (und davon gibt es viele!) eine größere Tiefe als so manche Hauptfiguren anderer Romane, Filme oder Serien aus dieser Zeit. Und dieses Interesse – oder nennen wir es Empathie – bezieht sich nicht nur auf die Handelnden, sondern auch auf die Lesenden. Zwar ist nicht von der Hand zu weisen, dass Infinite Jest streckenweise sperrig, überkomplex oder auch schlicht langatmig ist, jedoch würde man David Foster Wallace unrecht tun mit der Unterstellung, er wolle damit nur zeigen, was er in Sachen schriftstellerisches Können zu bieten hat, ohne Rücksicht auf Verluste in Sachen Leser*innengeduld. Tatsächlich erfüllt jede noch so anstrengende Passage eine wohlüberlegte Funktion, sind in jeder noch so langatmigen Szene kleine, aber wichtige Details versteckt, werden Fäden gesponnen, die an anderer Stelle wieder aufgenommen werden. Und so laufen auch die Dialoge nie völlig ins Leere, sondern lediglich um ein paar Ecken, bis man an einem ganz anderen Punkt herauskommt, als man vom Startpunkt aus hätte erahnen können.
Neben all den Kommunikationsproblemen treibt die Protagonist*innen stets das Bedürfnis um, von anderen gehört und gesehen zu werden – und zwar als die Personen, die sie „wirklich“ sind, d. h. ohne sich verstellen oder in irgendeiner Art performen zu müssen. Dazu eine kurze Aufstellung der Incandenza-Kernfamilie: Im Zentrum steht Mutter Avril, gebürtige Kanadierin, Agoraphobikerin und Zwangsneurotikerin mit grammatikalischer Inselbegabung, deren auffälligster Zwang wohl darin besteht, in der selbstgewählten Rolle der unfehlbaren Übermutter zu bestehen. Sie ist permanent damit beschäftigt, ihren Kindern subtil zu vermitteln, dass sie sie in ihrer Individualität erkennt, bedingungslos liebt und bei allem unterstützt, was sie sich vornehmen; jedoch wirkt jede ihrer Bemühungen wie ein auswendig gelernter Elternratgeber. Avril ist die Witwe von James O. Incandenza, der zu Lebzeiten diverse Rollen eingenommen hat: Seine Expertise auf dem Gebiet der Optik nutzte er sowohl für die Mitentwicklung der staatlichen Annularfusionstechnologie als auch für seine eigenen Avantgarde-Filme; er gründete und leitete die Enfield Tennis Academy und hatte nicht zuletzt mit schweren Alkoholproblemen zu kämpfen. James schien durchaus in der Lage zu sein, hinter die Fassade seines talentierten, emotional aber völlig abwesenden Sohns Hal zu schauen, jedoch war jeder seiner Versuche, kommunikativ zu dem Jungen durchzudringen, zum Scheitern verurteilt. Insgesamt haben Avril und James drei gemeinsame Söhne: Der älteste ist Football-Profi Orin, der, wie so viele Kinder exzessiver Alkoholiker*innen und Zwangsneurotiker*innen (so jedenfalls lernt man in Infinite Jest) einen deutlichen Hang zur Hypersexualität aufweist, gepaart mit einem deutlich ausgeprägten Grad an Selbstbezogenheit. Der jüngste Sohn ist Hal, aufstrebendes Tennis-Ass mit derselben sprachlichen Begabung mütterlicherseits. Hal leidet nicht etwa an überbordender Libido, sondern an so ziemlich genau dem Gegenteil, nämlich der Abwesenheit jeglicher inneren Gefühlsregung, auch „Anhedonie“ genannt. Er hat seit frühester Kindheit ein sehr feines Gespür dafür entwickelt, was er abliefern muss, damit seine Fassade aufrecht erhalten bleibt und er hat die richtigen Hilfsmittel dafür gefunden: allen voran “Bob Hope” bzw. Cannabis, das er täglich heimlich im Untergeschoss der E. T. A. raucht. Das Absetzen der Droge seiner Wahl und das vermutliche Experimentieren mit einer anderen, nicht so leicht im Urin feststellbaren Droge (DMZ) scheint ihm allerdings zum Verhängnis zu werden, denn wie ihm andere signalisieren, verliert er nach und nach die Kontrolle über Gesichtszüge und Sprachfähigkeit.
Der mittlere Sohn Mario fällt nicht nur optisch völlig aus dem Familienmuster: Er ist von Geburt an in höchstem Maße körperlich deformiert und kann sich nur mit Hilfe eines verstellbaren Polizeischlosses aufrecht fortbewegen. Aufgrund seiner fast kindlichen Aufrichtigkeit (sic) ist man schnell geneigt anzunehmen, er sei auch geistig beeinträchtigt, jedoch würde man ihn damit unterschätzen. Nicht nur, dass Mario Talent hinter der Kamera hat und nach dem Tod des Vaters weiter eigene Filme produziert; er ist auch einer der wenigen Protagonist*innen – und zumal der Einzige im Incandenza-Kosmos –, der die Dinge und Menschen, die ihn umgeben, genau wahrnimmt. Das trifft u. a. auch auf die tief sitzende Traurigkeit seines Bruders Hal zu, mit dem er sich in der E. T. A. ein Zimmer teilt und den er aufrichtig liebt. Da Mario frei ist von jeglichen Ambitionen, die die Tenniskids und alle anderen „normalen“, d. h. nicht physisch deformierten Personen um ihn herum an- und umtreiben, ist er ebenso frei vom Druck der permanenten Performance. Andere suchen auffällig gern Marios Nähe – vermutlich, weil sie spüren, dass sie in seiner Gegenwart ausnahmsweise mal nichts beweisen oder abliefern müssen.
In schlaflosen Phasen verbringt Mario ab und an Zeit im nahe gelegenen Ennet House, wo er neben all den anderen grotesken Gestalten kaum auffällt. Dabei stellt er fest, dass die Bewohner*innen des Ennet House nicht diese traurige Aura umweht, wie er sie in der E. T. A. wahrnimmt. Dieser Umstand dürfte wohl damit zusammenhängen, dass Erstere nicht in permanenter Konkurrenz um die beste Performance zueinander stehen. Die meisten Bewohner*innen sind zunächst einmal mit dem eigenen Überleben beschäftigt und so sehr von ihren körperlichen und psychischen Grundbedürfnissen absorbiert, dass sie sich um alles sorgen, nur nicht um die Frage, wie sie wohl am besten bei anderen herüber- und ankommen. Und falls beim allabendlichen Hose-Herunterlassen in den AA-Meetings doch einmal jemand auf die Idee kommt, die eigene Abstiegsgeschichte mit dem Sympathie-erheischenden Kalkül der Selbstironie zu spicken, wird der- oder diejenige sofort von der Gruppe sanktioniert. Was bei den AA-Meetings verlangt wird, ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit.
Im Zentrum des Ennet-House-Kosmos wiederum steht Donald (“Don”) Gately. Wie die meisten seiner Leidensgenoss*innen hat er vor dem Entzug seine gesamte Energie dafür aufgewendet, an die nächste Dosis (in seinem Fall ein Opioid, das starke Schmerzmittel Demerol®) zu kommen, um die nach dem Entzug verbliebene Energie nun dafür aufzuwenden, die Durchhalteparolen bzw. Mantras der AA- Mentor*innen zu verinnerlichen und nach etwas zu suchen, das das innere schwarze Loch, welches vorher durch die Droge verdeckt worden war, zu stopfen vermag. Bei einem der allabendlichen AA-Meetings registriert Gately, dass er zum ersten Mal in seinem Leben in der Lage ist, einer Person wirklich zuzuhören, wenn diese ungeschönt vor allen anderen ihren familiären, sozialen und körperlichen Abstieg schildert, an dessen Ende sie in den existenziellen Abgrund geblickt haben. Zum ersten Mal in seinem Leben stellt Gately aufrichtige Fragen an sich und andere und findet im Verlauf der Handlung sogar die Kraft, sich seinen Dämonen in Form von flashbackartigen Alpträumen zu stellen.
Was dieser kurze Rundumschlag veranschaulichen soll, ist, dass Authentizität in Infinite Jest stets im Kontext von Körperlichkeit, gar von Schmerz und Leid verhandelt wird und gerade nicht im Kontext des Gefallen-Wollens; dass authentische Momente, authentische Kommunikation nur dort gelingen, wo die Protagonist*innen in irgendeiner Form auf sich selbst und ihre nackte Verletzlichkeit zurückgeworfen sind und jede Art von Intention keine Rolle spielt. Das steht natürlich vollkommen konträr dem gegenüber, was die sozialen Medien auszeichnet – und zwar nicht nur, wenn man die allzu schönen Bildergalerien auf Instagram heranzieht oder hinter Dingen wie #bodypositivity v. a. Imagekampagnen vermutet. Die sozialen Medien sind per se Repräsentierende der Mittelbarkeit. Die Person auf der einen Seite des Bildschirms kann immer nur das betrachten, was die Person auf der anderen Seite des Bildschirms als ihre eigene Authentizität begreift und/oder vermitteln will. Irgendeine Art von Filter, von Intention ist einfach immer da, selbst wenn man es als Influencer*in wirklich ernst meint mit dem #nofilter-Aufruf und das Abbilden von Makeln und Nichtperfektion eben nicht nur als Teil des eigenen, vermarktungstechnisch relevanten Images, des Unique Selling Points, ansieht. Körperlichkeit hat hier nichts Unmittelbares, kann es nicht haben, sondern wird stets in kanalisierter Form wiedergegeben.
Anders ausgedrückt, sind die Personen auf der einen und der anderen Seite des Bildschirms nie ganz in demselben Moment. Behalten wir diesen Gedanken mal für das nächste Kapitel im Hinterkopf.
– IV –
Um die Genre-Frage vorerst abzuschließen: Wahrscheinlich ist Infinite Jest dann doch nicht unbedingt das Buch der Wahl unter Dystopie-/Science-Fiction-Fans. Denn wenn man davon ausgeht, dass Dystopische oder SciFi-Literatur ihren Stoff hauptsächlich aus der Frage bezieht, wie sich individuelle Verhaltensweisen und Sozialbeziehungen dadurch verändern, dass das gesellschaftliche Default Setting in etwas anderes umschlägt oder bereits umgeschlagen ist, dann unterscheidet sich Infinite Jest grundlegend von dieser Betrachtungsweise. Die Welt da draußen tritt nämlich nur am Rand und eher symbolisch als Bedrohungsszenario in Erscheinung. Was die Außenwelt für die Protagonist*innen zur Gefahr macht, sind nicht etwa die postapokalyptischen Annularfusionsfolgeerscheinungen oder der tödliche „Samisdat“, sondern die ganz realen gegenwärtigen Verlockungen und Wahlmöglichkeiten, mit denen das postmoderne Individuum so seine Schwierigkeiten hat.
Für die angehenden Tennisprofis der E. T. A. ist die Außenwelt gleichbedeutend mit der “Show”, also dem Auftritt auf der internationalen Tennisbühne, der Ruhm, Anerkennung oder sogar Erlösung verheißt. Ihre Coach*innen wissen nur allzu gut, dass mit diesen Verheißungen v. a. die Gefahr einhergeht, die Bodenhaftung zu verlieren; entsprechend versuchen sie ihre Coachees so lange wie möglich von der Außenwelt abzuschotten und in den täglichen ermüdenden Trainingseinheiten darauf zu konditionieren, dass es auf nichts anderes ankommt, als den kleinen gelben Ball vor sich zu treffen.
Für die Bewohner*innen der Ennet House Entzugsklinik hingegen bedeutet die Außenwelt, das “Out There”, in erster Linie die Gefahr eines Rückfalls in die Sucht und alte destruktive Gewohnheiten. Sie versuchen sich selbst so lange wie möglich von äußeren Einflüssen abzuschotten und klammern sich dabei an die Mantras ihrer AA-Mentor*innen, die im Wesentlichen darin bestehen, unter keinen Umständen – und sollten sie sich auch noch so stabil fühlen – von der täglichen, mitunter ermüdenden Routine der AA-Meetings abzulassen.
Wie sich zeigt, bewegen sich die Hauptprotagonist*innen in Infinite Jest in ihren je eigenen Mikrokosmen, die wiederum von den gesellschaftlichen oder gar politischen Einflüssen um sie herum relativ unbeeinflusst bleiben. Im Gegensatz zur klassischen Dystopischen oder SciFi-Literatur geht es (in) Infinite Jest also weniger um gesellschaftliche Default Settings und Gruppendynamiken als um die rein individuellen Default Settings, die von jenen zwar nicht gänzlich abzukoppeln, aber dennoch individuell anders justiert sind.
Unendliche Zwischenräume
Der aus der Informatik stammende Begriff “Default Setting” ist an dieser Stelle ganz bewusst gewählt, denn es soll im Folgenden um die 0-1-Struktur gehen, die der Computerprogrammierung zugrunde liegt. Laienhaft gesprochen, ist mit dem Default Setting die „Standardeinstellung“ gemeint, das heißt der Zustand, der zunächst einmal vorliegt (0), bevor etwas daran verändert wird (1). Überträgt man diese Logik auf die gesellschaftliche Ebene, dann bildet das D. S. den Referenzrahmen, an dem sich eine Gesellschaft orientiert, das heißt die Kombination all dessen, was sie mehrheitlich als legitim oder normal definiert. Natürlich ist dieser gesellschaftliche Normalzustand ungemein komplex, d. h. die Gesamt-0 setzt sich in Wirklichkeit aus einer Vielzahl von Nullen in verschiedenen Bereichen zusammen. Er ist außerdem keineswegs statisch, sodass eher im mathematischen Sinne von einer permanenten „Annäherung an 0“ gesprochen werden müsste oder von dem „kleinsten gemeinsamen Nenner“, auf den sich die Gesellschaftsmitglieder mehrheitlich in einem bestimmten historischen Moment irgendwie einigen können. Doch all diese Relativierungen zum Trotz lassen sich durchaus bestimmte allgemeine Aussagen über den gegenwärtigen Null- oder Normalzustand treffen, wie beispielsweise „Wir leben in einer ‚Sozialen Marktwirtschaft’“, „Es gilt die Unschuldsvermutung“, „Im Zweifel für den Angeklagten“, „Minderheiten werden geschützt“, „Ohne Moos nix los“ oder „Die Letzten beißen die Hunde“ etc.
Da unser Gehirn nun einmal so programmiert ist, dass es ausschließlich Differenzen wahrnimmt, ist uns dieser Normalzustand meist überhaupt nicht bewusst. Wie die oben erwähnten Fische, haben wir meist nicht den blassesten Schimmer, was eigentlich Wasser ist. Wir bemerken den Normalzustand erst dann, wenn wir Vergleiche anstellen oder der Zustand sich grundlegend verändert hat, das heißt die 0 in eine 1 umgeschlagen ist. Ganz besonders deutlich wird das bei abrupten Veränderungen, die meist durch äußere Ereignisse herbeigeführt werden, wie beispielsweise Naturkatastrophen, terroristische Anschläge, Reaktorunfälle oder auch Pandemien. Sie erfordern eine schnelle Reaktion und Anpassungsleistung und es entsteht der eigenartige Effekt, dass die Gesellschaftsmitglieder den alten Normalzustand sehr klar vor Augen haben, sich aber recht schnell kaum noch vorstellen können, wie sie zuvor, ohne die neuen Anpassungen, ihren Alltag gestaltet haben. Die alte 0 ist in eine 1 umgeschlagen, die sich im Laufe der Zeit als neue 0 durchsetzt, bis sich wiederum etwas Grundlegendes an dem aktuellen Zustand verändert und die 0 wiederum in eine neue 1 umschlägt.
Dieses Umschlagen in einen neuen Zustand kann andererseits aber ebenso schleichend erfolgen und tut dies auch viel häufiger – im Prozess vielfältiger innergesellschaftlicher Aushandlungen, die dafür sorgen, dass sich die Gesellschaft als Ganzes in eine(r) bestimmte(n) Richtung weiterentwickelt. Hier ist man wiederum sehr viel näher an der Mathematik als an der Informatik. Denn was in der binären 0-1-Logik nicht abgebildet wird, ist der mathematische Umstand, dass sich zwischen der 0 und der 1 ein unendlicher Zwischenraum aus gebrochen-rationalen Zahlen befindet. Selbst wenn sich mathematisch beweisen lässt – was der Fall ist! –, dass 0,99 Periode gleich 1 ist, so ist die 0,99 … 9 in irgendeinem Raum-Zeit-Kontinuum einmal auf die 0,99 … 8 gefolgt und diese 0,99 … 8 ist eben noch nicht gleich 1 – ganz zu schweigen von der 0,98 … usw. usf. Wiederum übertragen auf gesellschaftliche Zusammenhänge, ist es über Vergleiche dennoch möglich, die momentan neue 1 im Gegensatz zur herkömmlichen 0(-Komma-Irgendwas) auszumachen. Besonders gut lässt sich das am Beispiel des öffentlich Sagbaren zeigen: So kann es heute vorkommen, dass sich ein Unternehmensfunktionär aufgrund des öffentlichen Drucks gezwungen sieht, seinen Posten zu räumen, weil er eine rassistische oder misogyne Äußerung getätigt hat, die noch vor ein, zwei Dekaden niemanden hinter dem Ofen der Empörung hervorgeholt hätte. Aus der 0 = „Kann man ohne Weiteres öffentlich sagen“ ist eine 1 = „Sollte man sich gut überlegen, ob man es öffentlich ausspricht und muss im Zweifelsfall mit Widerspruch und Konsequenzen rechnen“ geworden.
Ob nun schlagartig oder schleichend – die Veränderung des gesellschaftlichen D. S. oder Referenzrahmens geht immer auch mit der Veränderung von Erwartungen und Ansprüchen einher, die die Mitglieder an die Gesellschaft legitimerweise stellen. In modernen, wohlhabenden Gesellschaften gehen diese Ansprüche und Erwartungen (kurz: Referenzpunkte) sehr weit über die basale Bedürfnisbefriedigung hinaus und sie verschieben sich je nach Veränderung des D. S. immer weiter. Da uns diese Bewegung aber aufgrund unseres neurologischen D. S. in der Regel nicht auffällt, kann das paradoxe Effekte haben. Ein Paradebeispiel dafür ist die soziale Beschleunigung: Einerseits haben uns die technologischen Innovationen der letzten 100 + Jahre so viel Arbeit abgenommen, dass eigentlich wahnsinnig große Zeitreserven entstanden sein müssten. Genau das Gegenteil ist aber der Fall, d. h. wir haben stattdessen immer weniger Zeit zur freien Verfügung. Der Grund dafür liegt darin, dass unser gesellschaftlicher Referenzpunkt eben nicht mehr an der Postkutsche haftet, sondern sich in Richtung 5 G-Netz mitbewegt hat. Die Ansprüche und Erwartungen sind entsprechend gewachsen und so muss eine Tätigkeit, die früher gut und gern einen kompletten Tag in Anspruch genommen hat, heute in einer Minute erledigt werden. „Wie gewonnen, so zerronnen“ – auf nichts trifft diese Redensart wohl besser zu als auf Zeitreserven.
Ebenso kann die unbewusste Referenzpunktverschiebung auch gefährliche Effekte haben. Denn durch die Verschiebung weg von einer festen Größe, einer Basis, bilden sich Blasen, die irgendwann platzen – mit zum Teil verheerenden gesamtgesellschaftlichen Folgen. Beispiel ökonomische Blasen: Anspruch und Erwartung der Gesellschaft liegen im stetigen Wachstum der Wirtschaft. Wenn dieses Wachstum aber immer weniger durch realwirtschaftliche Wertschöpfung und immer mehr durch Verschuldung und virtuelle Geldproduktion generiert wird, dann entsteht ein spiralförmiger Kreislauf, in dem sich die Finanzmarktlogik immer weiter von der sogenannten Realwirtschaft ablöst. Das geht so lange gut, bis eines dieser Elemente gestört wird und das ganze künstliche Konstrukt in sich zusammenbricht. Die Banken können kein Geld mehr ausgeben, Kreditnehmer*innen ihre Kredite nicht mehr bedienen und schließlich muss der Staat einspringen. Oder nehmen wir die virtuellen Filterblasen (Echokammern, Rabbit Holes etc.): Sie entstehen dadurch, dass sich User*innen im Netz zunächst virtuelle Plattformen suchen, auf denen ihre eigenen Annahmen aufgegriffen und bestätigt werden; in der Folge blenden sie andere Informationsquellen zunehmend aus und werden stattdessen, dem Algorithmus sei Dank, mit Content versorgt, der ihre Annahmen reproduziert und immer noch ein kleines Stückchen weiter in eine bestimmte Richtung lenkt. Kombiniert mit dem sozialen Aspekt der Social Media, dem direkten Austausch mit anderen User*innen, die in dieselbe Richtung driften und sich gegenseitig darin bestärken, entsteht nach und nach eine radikalisierte Weltsicht, die sich von der Mehrheitsgesellschaft entkoppelt hat. Für die Öffentlichkeit bleibt dies so lange weitgehend unbemerkt, bis die Anhänger*innen von Verschwörungstheorien ihre Parolen aus der virtuellen Welt auf die Straße tragen oder sich eine Einzelperson durch ihre virtuelle Community legitimiert fühlt, der verbalen Gewalt im Netz physische Taten folgen zu lassen.
Spätestens an dem Punkt, an dem die Wirtschaft zusammenbricht und private Haushalte in Existenznot geraten oder an dem Punkt, an dem Attentate und Mordanschläge mit offen politischer oder religiöser Motivation verübt werden, nimmt die Öffentlichkeit besagte Verschiebung wahr und muss anschließend versuchen, die vielfältigen Prozesse, die aus der 0,99 … 8 irgendwann eine 1 haben werden lassen, zu rekonstruieren. An diesem Punkt ist die gesellschaftliche Betroffenheit und das Entsetzen groß und man setzt sich hehre Ziele, damit sich so etwas in Zukunft nicht wiederholt. Wie wir aber nur allzu gut aus eigener Erfahrung wissen – und mindestens einmal im Jahr erneut feststellen müssen –, ist das so eine Sache mit den guten Vorsätzen …
Halbleere und halbvolle Gläser
Damit sind wir auf der Ebene des individuellen Default Settings angelangt. Hier geht es gewissermaßen um die „Standardausstattung“, mit der ein Individuum auf die Welt kommt bzw. um den Referenzrahmen, innerhalb dessen sich seine eigenen Ansprüche und Erwartungen ans Leben (kurz: Referenzpunkte) ausprägen. Beides ist in das gesellschaftliche D. S. eingebettet und wird durch soziale und rein individuelle (Persönlichkeits-)Merkmale weiter geprägt. So hat beispielsweise ein Kind, das in den USA des späten 20. Jahrhundert mit einer arbeitslosen, suchtkranken Mutter und deren wechselnden gewalttätigen Partner*innen aufwächst (siehe Don Gately) ziemlich sicher andere Erwartungen und Ansprüche an das Leben als ein Kind, das in eine vielleicht ebenso suchtbelastete, aber akademisch geprägte und Talent fördernde US-Oberschichtfamilie hineingeboren wird (siehe Hal Incandenza). Und der von Geburt an massiv physisch deformierte andere Sohn dieser Oberschichtfamilie hat vermutlich abermals ganz andere Ansprüche und Erwartungen ans Leben als sein physisch nicht deformierter Bruder (siehe Mario Incandenza). Dennoch ist es ebenso möglich, dass sich das privilegierte Kind zu einem depressiven Erwachsenen entwickelt, wie das unterprivilegierte Kind es schaffen kann, sich mental recht unbekümmert durchs Leben zu bewegen oder Karriere zu machen.
Ausgehend von dieser individuellen Standardausstattung, innerhalb dieses individuellen Referenzrahmens finden ebenfalls beständig Verschiebungen statt, bei denen der Normalzustand 0 in einen neuen Zustand 1 umschlägt. Dies kann sich ebenfalls plötzlich vollziehen, wenn ein bestimmtes Ereignis oder ein Schicksalsschlag das eigene Leben von heute auf morgen komplett umkrempelt – beispielsweise wenn man sich Hals über Kopf verliebt oder von heute auf morgen verlassen wird, wenn man Opfer eines Unfalls wird oder einen Unfall verursacht, ein positives Testergebnis erhält o. ä. In diesen Fällen müssen sich die eigenen Ansprüche und Erwartungen blitzschnell an die neuen Gegebenheiten anpassen, mit dem oben schon erwähnten paradoxen Effekt, dass man sein Leben vor dem einschneidenden Ereignis klar vor Augen hat und es sich gleichzeitig nicht mehr vorstellen kann.
Wiederum sehr viel häufiger finden die individuellen Verschiebungen aber schleichend statt, d. h. es braucht eine ganze Reihe von Einzelereignissen, bis aus der Normal-0 eine 1 wird. Das ist z. B. nach dem Abklingen der ersten Verliebtheitsphase der Fall, wenn man anfängt, sich durch Angewohnheiten und Merkmale der geliebten Person gestört zu fühlen, die man zuvor nicht einmal bemerkt hat oder man die ständige Nähe, die anfangs das Einzige war, was zählte, zunehmend als beengend empfindet. Das Bedürfnis nach totaler Verschmelzung und Sicherheitsgefühl in der ersten Phase ist in das Bedürfnis nach mehr Freiheit umgeschlagen. Oder wenn man nach dem ersten Schock des Verlassen-Werdens die verschiedenen Phasen der Trauer durchläuft: Leugnen und Nicht-Wahrhaben-Wollen schlägt in Wut um, die sich wiederum in die innere Verlustverarbeitung transformiert, aus der dann idealtypisch die Suche nach einem neuen Welt- und Selbstbezug hervorgeht. Oder aber wenn man sich aus Singlefrust täglich ein klitzekleines Ananas- oder Maracuja-Fruchtgummi mehr gönnt – man hat ja sonst nicht so viel Südsee-Feeling im Leben –, was sich lange Zeit auf der Waage nicht auswirkt, bis die Jeans sich irgendwann doch nicht mehr schließen lässt und man sich eingestehen muss, dass man lieber seinen kompletten Kleiderschrank auswechseln würde als auf die heißgeliebte tägliche Fruchtgummi-Tüte mit dem freundlich-zugewandten Tukan auf dem Cover zu verzichten. Der Frust- oder Belohnungskonsum ist in eine Abhängigkeit umgeschlagen.
Genau diese schleichenden Verschiebungen sind elementarer Bestandteil von Infinite jest – womit sich nicht zuletzt auch die riesige Differenz zwischen Erzählzeit (also der Zeit, die man ungefähr braucht, um das Buch durchzulesen) und erzählter Zeit des Romans erklären lässt. Die Haupthandlung, die sich über 1000 großformatige Seiten spannt (Fußnoten eingerechnet), umfasst nämlich einen Zeitraum von gerade mal drei Wochen. Es braucht eben Zeit, um all die kleinen Details und Einzelereignisse zu beschreiben, die für die inneren Referenzpunktverschiebungsprozesse der Hauptprotagonist*innen relevant sind. Auf der einen Seite ist da der mühselige Aufwärtstrend der angehenden Tennisprofis in der E. T. A., ihr täglicher Kampf darum, den eigenen Erwartungen und denen ihrer Coach*innen zu entsprechen, indem sie ihren aktuellen Ranglistenplatz mindestens verteidigen und möglichst das nächsthöhere „Plateau“ erreichen. Zum anderen ist da der kontinuierlich steiler werdende Abwärtstrend hinein in die substanzgebundene Sucht oder klinische Depression, wobei beides häufig miteinander einhergeht. Diesen Abwärtstrend bis hin zum existenziellen Tiefpunkt haben die Bewohner*innen des Ennet House wiederum mindestens einmal bereits hinter sich. Sie befinden sich mittlerweile zum großen Teil auf einem vorsichtigen Vorwärtstrend, bei dem es zunächst einmal darum geht, jeden einzelnen Tag zu überstehen, ohne vom inneren schwarzen Loch und dem Verlangen nach der Droge der Wahl verschlungen zu werden.
The Gift of Total Focus
Die Parallelen zwischen Profisport und Sucht sind in Infinite Jest keineswegs willkürlich, sondern von David Foster Wallace ganz bewusst gewählt. Denn auf beiden Feldern geht es letztlich um dasselbe: die totale und kompromisslose Hingabe an eine Sache. Bis jemand allerdings an diesem Punkt ankommt, haben sich bereits eine Vielzahl kleinerer und größerer Referenzpunktverschiebungen vollzogen: Irgendwann fängt man mal ganz unbedarft an, aus Langeweile oder Neugierde und stellt fest, dass man eine gewisse Grundneigung zum Sport oder zum Stoff der Wahl hat; es stellen sich erste Erfolgs- und/oder Rauscherlebnisse ein, die man unbedingt wiederholen möchte; auch das Umfeld signalisiert einem, dass man dranbleiben sollte – entweder weil man talentiert ist und sich dadurch von anderen abheben kann oder weil man eben gerade kein besonderes Talent für irgendetwas zu haben scheint und sich einfach weiter mittreiben lässt. Die Rauscherlebnisse nehmen an Intensität und Häufigkeit zu, ebenso wie die negativen Empfindungen bei Niederlagen und dem Runterkommen, die man zu kompensieren versucht, indem man immer noch ein bisschen mehr trainiert oder konsumiert, bis man schließlich fast seine komplette Zeit und Energie dem Sport oder dem Stoff widmet.
Hier ist es dann endgültig vorbei mit der anfänglichen Unbedarftheit; an ihre Stelle tritt ein immer weiter steigender Druck, sowohl innerlicher Art (Leistungslevel steigern, Pegel erhöhen etc.) als auch äußerlicher Art (Coach*innen und Publikum zufriedenstellen, diverse Gläubiger*innen bedienen etc.). Ein halbwegs normales Sozialleben bleibt zwangsläufig auf der Strecke – man muss sich fokussieren; das Wechselspiel aus unermesslichem Druck, Selbstzweifeln und Einsamkeitsgefühl auf der einen, völlig enthemmtem Rauscherlebnis und Selbstüberhöhung auf der anderen lässt einen den Boden unter den Füßen verlieren; die Abstände zwischen beiden Extremen werden zunehmend kleiner.
An dieser Stelle enden die Parallelen zwischen Profisport und Sucht vorerst, denn während es für die angehenden Profisportler*innen vermeintlich immer weiter nach oben geht, über körperliche Grenzen hinaus, führt der Weg der Abhängigen stetig und steil nach unten, an den Rand der Sterblichkeit. Die Parallelen setzen aber spätestens dort wieder ein, wo die Abhängigen ihren mental-physischen wie sozial-menschlichen Tiefpunkt überwunden haben, sich langsam wieder aufrappeln und versuchen, die Energie, die aus der vormaligen totalen Hingabe frei geworden ist, in etwas weniger Destruktives umzuwandeln. Die zuvor ungebändigte Energie muss nun künstlich kanalisiert werden – und so sind die Tage in der Entzugsklinik von strengen Abläufen und Ritualen geprägt, was wiederum der Tagesstruktur einer Sportausbildungsstätte nicht unähnlich ist. Erneut geht es um die reine mentale Fixiertheit auf eine Sache – nur diesmal eben nicht aus einem Verlangen heraus, sondern aus (Selbst-)Zwang. Am Ball bleiben (metaphorisch und im Wortsinn), komme was wolle, tagein, tagaus; nicht nachdenken, nicht nach links und rechts schauen, sondern einfach weitermachen, auch wenn man es einfach leid ist, sich unendlich müde fühlt und/oder einem vor Schmerzen die Knochen klingeln wie Leute manchmal sagen, ihnen würden die Ohren klingeln. One Day At A Time. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel.
Mindestens einen entscheidenden Unterschied zwischen Profisport und Sucht gibt es dann allerdings doch, nur besteht dieser weniger, als vielleicht zu erwarten wäre, im Faktor Sozialprestige oder im Faktor Ehrgeiz bzw. Selbstdisziplin, als vielmehr im Faktor Leidensdruck. Denn während die angehenden Profisportler*innen zwingend darauf angewiesen sind, diesen Leidensdruck, d. h. die mentalen und körperlichen Qualen, denen sie sich in den täglichen ausgedehnten Trainingseinheiten aussetzen müssen, jeden Morgen aufs Neue zu verdrängen und wieder von vorn zu beginnen, weil sie sonst keine Chance hätten, ihr eigenes Leistungslevel zu steigern und gegenüber der Konkurrenz zu bestehen, wird genau diese enorme Verdrängungsleistung den Abhängigen zum Verhängnis – und zwar unabhängig davon, ob sie sich in der aktiven Phase der Sucht oder in der aktiven Phase des Entzugs und der Abstinenz befinden.
In der aktiven Suchtphase sollte man annehmen, dass die psychischen und physischen Schmerzen, die die Abhängigen bei jedem Runterkommen erleiden, für sich genommen ausreichen müssten, damit sie bei der nächsten Gelegenheit die Finger von der Droge ihrer Wahl lassen. Jedoch sind genau diese psychischen und physischen Schmerzen so präsent und alles absorbierend, dass es nur einen Ausweg aus der Qual zu geben scheint: die nächste Dosis. Je stärker die Schmerzen, desto höher die Dosis, desto stärker die Schmerzen, desto … Entscheidend ist hier der Fakt, dass es sich um einen schleichenden Prozess handelt. Um nach den Fischen eine andere (bekanntere) Metapher zu bemühen, die mit Wirbeltieren und Wasser zu tun hat: Die Abhängigen sind vergleichbar mit Fröschen, die in ihrem je eigenen Topf sitzen und nicht bemerken, wie sich das Wasser um sie herum langsam bis zum lebensbedrohlichen Siedepunkt erhitzt. Ein Frosch, der von außerhalb in einen Topf mit kochendem Wasser springt, würde dagegen sofort wieder herausspringen; er hat die schleichende 0-1-Verschiebung eben nicht durchlebt und bemerkt sofort die Lebensgefahr.
Nach dem Entzug blicken die Abhängigen gewissermaßen selbst ungläubig in den Topf mit kochendem Wasser, aus dem sie sich gerade noch rechtzeitig befreien konnten. In dieser Phase sind sie darauf angewiesen, sich das Leid der aktiven Phase der Sucht permanent in all seinen unerträglichen Facetten zu vergegenwärtigen, um trotz aller Strapazen, die auch die Abstinenz so mit sich bringt, immer weiterzumachen. Anfangs funktioniert das meist auch noch ganz gut, weil die Erinnerung daran, wie es sich anfühlt, in viel zu heißem Wasser zu sitzen, noch eine Weile präsent ist. Nach und nach verblasst die Erinnerung aber eben doch und das Gefühl von absoluter Verzweiflung geht über in das Gefühl von relativer Stabilität, einhergehend mit immer weiteren kleineren Zugeständnissen an sich selbst bis hin zur Selbstüberschätzung, von wo aus es nur noch ein kleiner Schritt zurück in den Wassertopf ist. Zeitgleich kehrt auch die innere Leere, das innere schwarze Loch, das von der Droge der Wahl so lange einigermaßen überdeckt werden konnte, schleichend zurück, bis der Leidensdruck der Abstinenz den Leidensdruck der aktiven Sucht übertrifft und es für die Abhängigen abermals nur noch einen Ausweg zu geben scheint: die nächste Dosis.
Wie oben erwähnt, ist die Crux des Referenzpunkts, dass er dazu tendiert, sich langsam, schleichend, weitestgehend unbewusst immer weiter zu verschieben – weg von einer festen Basis, die im Fall der Abhängigen der Leidensdruck der aktiven Sucht (bzw. die Erinnerung daran) darstellt. Auch hier bildet sich also eine Blase, die verheerende Auswirkungen für die Betroffenen und ihr Umfeld mit sich bringt, irgendwann platzt und sich nach dem Platzen mehr oder weniger schnell wieder neu bildet, um erneut zu platzen und sich wieder zu bilden und zu platzen usw. Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen und nachhaltig zu stören, reicht es nicht aus, den Abhängigen jeden Tag einen Topf mit kochendem Wasser vor die Nase zu stellen, d. h. an ihre Vernunft oder das Erinnerungsvermögen zu appellieren. Der Stoff hat eine übermächtige Anziehungskraft und Wirkung, die den Verstand übersteigt und so muss auch das Gegenstück, die Abstinenz, bedeutungsmäßig überhöht werden.
Entsprechend gleichen die AA-Meetings in Infinite Jest v. a. religiösen oder spirituellen Erweckungsveranstaltungen, in denen die Teilnehmenden auf die Gabe der Verzweiflung (“The Gift of Desperation”) eingeschworen werden, die sie dazu befähigt, der Krankheit (“The Disease” oder auch “The Spider”) zu trotzen, indem sie jeden einzelnen Tag aufs Neue (“One Day At A Time”) dem übermächtigen Verlangen widerstehen und weiterhin zu den Meetings kommen (“Keep Coming”). Sie werden darauf eingeschworen, sich in die anderen Teilnehmer*innen hineinzuversetzen (“Identifying”) und nicht dem Irrglauben zu verfallen, sie seien die große “One-in-a-million”-Ausnahme und gehörten nicht dorthin bzw. könnten es ohne permanente Unterstützung von außen schaffen, dem Topf mit heißem Wasser auf Dauer fernzubleiben. Nur indem sie sich mit den anderen und deren wechselnd vorgetragenen persönlichen Abstiegsgeschichten identifizierten, seien sie in der Lage, die heilige Botschaft zu empfangen und weiterzugeben (“Carrying The Message”).
Zusammengefasst lautet diese Botschaft schlicht: “Keep Coming”, also „Komm weiter zu den Meetings“. Ein Zirkelschluss, der so einige der Ennet-House-Bewohner*innen zunächst einmal zur Verzweiflung bringt, weil sie sich irgendeine Art von Erlösung und Sinn erhoffen und stattdessen wohl oder übel feststellen müssen, dass der einzige Sinn darin besteht, nicht weiter nach einem festen Sinn zu suchen. Doch solange sie sich auf die Karotte konzentrieren, die ihnen vor der Nase baumelt und auf der gut lesbar KEEP COMING steht, wenn sie nicht nach links und rechts schauen, nichts analysieren, dann haben sie laut AA-Philosophie eine realistische Chance, auf dem rechten Pfad zu bleiben.
You Can’t Have Your Carrot And Eat It
Die Baumelnde-Karotten-Metapher taucht in Infinite Jest im Übrigen mehrfach auf, v. a. im Kontext der E. T. A. Hier steht die Karotte für das nächste „Plateau“, den nächsthöheren Ranglistenplatz, auf dessen Erreichen sich die Tenniskids fokussieren sollen, ohne sich von irgendwelchen Einflüssen und Verlockungen aus der Außenwelt ablenken zu lassen. Insbesondere die jüngeren Tenniskids machen den Fehler, die Karotte von vornherein viel zu hoch zu hängen und der Idee einer großen Tenniskarriere nachzujagen, die für sie der Inbegriff von Erfüllung und sogar Erlösung ist. Aufgabe der Coach*innen ist es dann zunächst, die Karotte Stück für Stück niedriger zu hängen, sodass die Botschaft KEEP HITTING THE GODDAMN BALL gut sichtbar wird. Unterstützt werden sie dabei unbewusst vom hauseigenen E. T. A.-Guru Lyle, den die verzweifelten Tenniskids im Kraftraum aufsuchen und um Rat bitten und der ihnen mit Engelsgeduld erklärt, dass selbst die ultimative Karotte, das Erreichen der “Show”, keineswegs eine Art von Erlösung bringt. Denn wie es Karotten, die einem metaphorisch vor der Nase baumeln, nun einmal so an sich haben, kann man sie nie wirklich erreichen. Sobald man die Karotte „erwischt“ zu haben glaubt, rückt sie in Wirklichkeit immer nur ein kleines Stückchen weiter weg bzw. wird durch eine neue ersetzt. Und so kommt mit dem Erreichen von Ruhm und Ansehen nichts anderes als die Angst vorm Verlust von Ruhm und Ansehen und das Bedürfnis nach mehr Privatsphäre und Normalität.
Im Übrigen ist es genau dieses Wirkprinzip der baumelnden Karotte, das auch den Erfolg und Appeal des Kapitalismus ausmacht. Wie oben schon dargestellt wurde, geht es beim Konsum eben gerade nicht um die Totalbefriedigung eines Bedürfnisses, sondern darum, beständig neue Bedürfnisse zu generieren. Der Kapitalismus suggeriert, dass ein bestimmtes Bedürfnis durch den Kauf eines bestimmten Produkts befriedigt werden könnte, jedoch bildet sich direkt nach dem Konsum sogleich ein neues Bedürfnis, das wiederum durch ein anderes Produkt befriedigt werden muss. Dahinter steht ebenfalls ein großes Heilsversprechen, nämlich jenes, wonach man der inneren Leere, dem schwarzen Loch entkommen könnte, wenn man dieses oder jenes konsumiert. Bei genauerer Betrachtung steht auf der kapitalistischen Karotte allerdings nichts anderes als: KEEP CONSUMING. Ein Zirkelschluss, der auch hier funktioniert, solange sich die Konsument*innen darauf fokussieren und nicht nach links und rechts schauen.
Die Ausrichtung des Konsums hat sich in den letzten Jahrzehnten allerdings recht stark gewandelt, insofern als es dem Kapitalismus heute nicht mehr so sehr darum geht, ein bestimmtes Endprodukt zu verkaufen, sondern vielmehr darum, einen bestimmten Prozess zu vermarkten. Und die Ressource, auf die sich der Prozess richtet, sind die Konsument*innen selbst. Wie man an der mehr als lukrativen Achtsamkeits-/Self-Help-/Glücks-Industrie sehen kann, ist diese Ressource unendlich reproduzierbar, solange dafür gesorgt wird, dass die Referenzpunktverschiebung von 0 = „unzufrieden/suboptimal“ hin zur 1 = „zufrieden/optimal“ niemals aufhört bzw. die eine Verschiebung sofort an die nächste knüpft. Der weitgefächerte Markt der Selbstoptimierung lebt davon, dass der versprochene Endzustand niemals erreicht wird und stattdessen bei den Konsument*innen das Gefühl aufrechterhalten wird, immer noch ein kleines bisschen unzulänglich, ungenügend oder zu wenig glücklich zu sein. Es gibt schlicht immer etwas zu optimieren, seien es Essgewohnheiten, Lebenseinstellungen oder die oben erwähnte Authentizität. Und so lässt sich bspw. auch mit Minimalismus und Verzicht wunderbar Geld verdienen, schließlich steht immer ein*e Coach*in oder eine App zur Verfügung, die einem dabei behilflich ist herauszufinden, wie man es denn nun richtig anstellt mit dem Verzichten, Ausmisten und Sich-Reduzieren.
Doch mal abgesehen von diesem sich selbst reproduzierenden Wirkmechanismus ist es doch immer wieder erstaunlich, wie viele Individuen einen nicht unerheblichen Teil ihrer Zeit und ihres Geldes in diverse Self-Help-Formate investieren und damit letztlich in Mantras, die sich – mal ehrlich – in ihrer Banalität und ihrem Klischeegehalt nicht gravierend von den Mantras der AA-Veteran*innen in Infinite Jest unterscheiden. Eine Annahme, mit der sich dieses Phänomen erklären lässt, ist jene, wonach Verzweiflung, Einsamkeitsgefühl und das Bedürfnis nach Orientierung in dieser unserer gegenwärtigen Gesellschaft ein so gravierendes Ausmaß angenommen hat, dass viele das starke Bedürfnis verspüren, sich an einfache Wahrheiten und Sinnversprechen zu klammern. Eine andere Annahme lautet schlicht, dass der Leidensdruck eine höchst individuelle Angelegenheit ist. Im übertragenen Sinne: Man muss nicht zwingend in einem Topf mit kochendem Wasser sitzen, um so etwas wie Verzweiflung und Überforderung zu empfinden. Was sich für Person A schon nach mindestens 85° C heißem Wasser anfühlt, lässt Person B vielleicht noch nicht einmal die Hand zurückziehen, weil ihr ein normales Verhältnis zur Wassertemperatur abhanden gekommen ist oder sie noch nie eines hatte. Ich denke, wir können davon ausgehen, dass an beidem etwas dran ist, aber da für die Analyse der ersten Annahme hier der Platz fehlt, bleiben wir zum Schluss noch kurz bei der zweiten.
86.400 hoch unendlich
Wenn man ganz allgemein davon ausgeht, dass die Karotte für eine Aussicht steht, auf die man zuarbeitet, an der man sich orientiert und entlanghangelt – für das also, was einen den im besten Fall unsexy, im schlechtesten Fall unerträglichen Alltag irgendwie durchstehen lässt, dann lautet die entscheidende Frage: Wie hoch hängt (man) die Karotte innerhalb des eigenen Default Settings? Von welchem „Plateau“, von welcher 0 startet man, um sie zu erreichen? In Infinite Jest fällt die Antwort darauf erwartungsgemäß einigermaßen extrem aus, schließlich haben wir es hier mehrheitlich mit Protagonist*innen zu tun, die tendenziell eher kein gesundes Verhältnis zu Wassertemperaturen haben:
Da ist zum einen der talentierte 17-Jährige Hal, dem alle Türen offenzustehen scheinen. Dass er sich Plateau für Plateau bis auf Platz 2 der internen E. T. A.-Rangliste – hinter dem Kanadier John (“No Relation”) Wayne – hinaufarbeiten konnte, hat er allerdings in nicht unerheblichem Maße seinen heimlichen Konsultationen bei “Bob Hope” zu verdanken. Denn die tägliche Aussicht aufs High-Werden im Untergeschoss der E. T. A. hielt für lange Zeit seinen Kampf- und Lebensgeist aufrecht. Als er jedoch in Verdacht gerät und einer anstehenden Urinprobe wegen dringend abstinent bleiben muss, bezeichnet er (bzw. sein Auskenner-Freund Mike Pemulis) das passenderweise als “Abandon All Hope” (INFJ: 1064 (Fn. 321)). Er ist seiner inneren emotionalen Leere schutzlos ausgeliefert und verspürt nicht einmal mehr den Drang, Tennis zu spielen – oder überhaupt irgendetwas zu tun. Also legt er sich auf den Boden des Video Room 5 und fokussiert sich fürs Erste aufs Ein- und Ausatmen. Und so liegt er, verwirft die Frage, wie das Aufstehen wohl funktionieren könnte, als zu komplex, und atmet ein und atmet aus.
Für Katherine (“Kate”) Gompert wäre Hals Zustand dagegen ein erstrebenswerter. Gompert leidet an psychotischer Depression, einer schweren Form der Depression, die sie selbst als unerträgliches Gefühl beschreibt, so als würde jede einzelne ihrer Körper- und Gehirnzellen von einer starken Übelkeit befallen sein und sich übergeben wollen – und das ohne Unterlass, die ganze Zeit. Auch sie übersteht den Tag lange Zeit nur mit der Aussicht auf den täglichen Cannabis-Konsum, der ihr hilft, die unerträglichen psychischen Qualen wenigstens kurz abzumildern. Diese Karotte ist nun vorerst weggefallen, nachdem sie nach ihrem letzten Suizidversuch in der Psychiatrie und schließlich im Ennet House gelandet ist und wie alle anderen abstinent bleiben muss. Das Einzige, worauf sie sich im Moment noch fokussieren kann, ist die Hoffnung, der nächste Moment möge so erträglich sein, dass sie nicht vor Verzweiflung aus dem Fenster springen muss. Dabei hat sie stets das Beispiel eines ehemaligen Psychiatrie-Mitpatienten, Mr. Earnest Feaster, im Hinterkopf. Der strenggläubige Feaster hatte bei ihrem Kennenlernen bereits unvorstellbare 17 Jahre an psychotischer Depression gelitten, ohne jemals ernsthaft Suizid in Betracht gezogen zu haben. Stattdessen ersehnte er nichts mehr als den Tod im Leben, einen Zustand kompletter psychischer Betäubung und Bewusstlosigkeit, den er schließlich mithilfe eines radikalen psychochirurgischen Eingriffs zu erreichen versuchte. Gompert hat nie gewagt genauer nachzufragen, aber es ist davon auszugehen, dass sich bei Feaster keine neue Karotte mehr gebildet hat, nachdem ihm das komplette limbische System herausgetrennt wurde.
Den dringlichen Wunsch nach Bewusstlosigkeit verspürt auch Tony (“Poor Tony”) Krause, ein Transgender-Junkie aus der Unterwelt Bostons. Krause verliert durch die Verkettung einer Vielzahl von – sagen wir „ungünstigen“ – Einzelereignissen den Anschluss an seine Crowd, dadurch den Zugang zum Heroin sowie einen sicheren Unterschlupf und irgendwann auch den Zugang zur Behelfsdroge Hustensirup. Nur das Bewusstsein verliert er leider nie. Nicht, als er unfreiwillig in einem leeren Müllcontainer auf kalten Entzug gehen muss und auch nicht, als er von dort in die Toilette einer öffentlichen Bibliothek zieht, um alle Arten von Körperflüssigkeiten, die aus seinem Körper heraustreten, wenigstens einigermaßen kanalisieren zu können. Und auch als er schließlich doch noch alle verbliebenen Kräfte seines inzwischen nur noch 45-kg-schweren Körpers zusammennimmt, um seine Plan-C-Dealer aufzusuchen und in der U-Bahn auf dem Weg dorthin einen epileptischen Anfall erleidet, tut ihm sein Bewusstsein nicht den Gefallen, sich endlich auszuklinken. Poor Tony Krause bleibt während all dieser Phasen nichts anderes übrig als sich an die einzige Karotte zu klammern, die ihm noch bleibt, nämlich die Hoffnung, die nächste Sekunde möge schneller vergehen und nicht von einer Horde Ameisen um ihn herum weggetragen werden wie die vorherige.
Diesen Zustand kennt Don Gately nur zu gut aus der Anfangsphase seines Entzugs, als er tagsüber “the sharp edge of every second that went by” fühlte und nachts von “freakshow dreams” (INFJ: 280) der übelsten Art heimgesucht wurde. Nach dem Entzug befindet sich Gately dann zum ersten Mal in seinem Leben auf einem leichten Aufwärtstrend. Im Gegensatz zu einigen anderen Protagonist*innen wirkt sich seine Abstinenz tatsächlich durchweg positiv auf seine soziale Interaktionsfähigkeit aus; er ist ein beliebter Gesprächs- und Ansprechpartner, gewissermaßen die gute Seele des Ennet House, und entwickelt als neu ernannter Chefkoch den Ehrgeiz, seine Mitbewohner*innen allabendlich kulinarisch zufriedenzustellen. Mit Verwunderung stellt Gately fest, dass die Mantras der AA-Veteran*innen tatsächlich ihre Wirkung tun und es ihm jeden Tag aufs Neue gelingt, abstinent zu bleiben. Als er jedoch mit einer lebensbedrohlichen Schussverletzung im Krankenhaus landet, ist er plötzlich unfreiwillig mit der Droge seiner Wahl, dem starken Schmerzmittel Demerol®, konfrontiert. Im Schmerzfieber, unfähig zu sprechen, versucht er sich mit aller ihm verbliebenen Kraft gegen die ärztlich empfohlene Sedierung zu wehren, was allerdings bedeutet, unvorstellbare körperliche Schmerzen zu erleiden, die sich mit flashbackartigen Albträumen abwechseln. In diesem halbbewusst-bewussten Zustand sieht sich Gately gezwungen, das omnipräsente AA-Mantra “One Day At A Time” ein weiteres Mal in das Mantra “One Second At A Time” („Eine Sekunde nach der anderen“) umzuwandeln.
Was diese vier Protagonist*innen gemeinsam haben, ist, dass sie sich in ihrem je eigenen Locked-in-Zustand befinden, d. h. auf die eine oder andere Art bei vollem Bewusstsein in sich selbst und der Zeit gefangen sind. Zwar waren sie auch mit der Droge ihrer Wahl bereits Gefangene ihrer toxischen Gedanken, die zu 99 Prozent um sie selbst kreisten; jedoch verschaffte ihnen der Rausch wenigstens kurz die Möglichkeit, aus ihrem Kopf, ihrem Körper und der Zeit auszubrechen. Und so ist es nur logisch, dass der Leidensdruck keineswegs aufhört, sobald man von der Droge seiner Wahl ablässt. Im Gegenteil: Es gibt immer wieder diese extremen Phasen, in denen es nicht mehr ausreicht, sich von Tag zu Tag zu hangeln, sondern in denen man die Sekunden zählen muss – und die können extrem scharfe Kanten haben.
Genau diese kleinen, versteckten, sprachlich virtuos gestalteten Momentaufnahmen sind es, die Infinite Jest so einzigartig machen. Der Roman ist ohne Frage ein Universalwerk, das sich aus vielen verschiedenen Perspektiven betrachten lässt; er ist überbordend, überfordernd, übertrieben, ja, aber allein wegen seines spielerischen Umgangs mit Zeit und dem individuellem Zeitempfinden ist er die langwierige Lektüre mehr als wert – man muss nur den Mut haben, sich dem Leidensdruck des Dranbleibens zu stellen. Jedenfalls schafft es Infinite Jest wie nur wenige Romane, dass sich die lesende Person (vermutlich eines dieser überforderten postmodernen Individuen) ihres eigenen momentanen Default Settings bewusst wird. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen dieser Individuen ja sogar dabei, sich ein kleines Stück aus dem Rabbit Hole der Selbstoptimierung herauszubewegen und den Blick mal wieder etwas zu weiten. Im Vergleich zu Gompert, Krause & Co. kann die eigene Normal-0 eigentlich nur besser abschneiden.
– V –
Für den Schluss habe ich mir weitere fünf essenzielle Erkenntnisse aus Infinite Jest aufgehoben, die als mein bescheidener Beitrag zur Self-Help-Branche gewertet werden dürfen.
Erstens: Mantras helfen, nicht obwohl, sondern gerade weil sie so furchtbar banal und klischeebehaftet sind. Sie stellen gewissermaßen geronnene Zeit dar, das Kondensat aus Abermillionen gesammelter Einzelerfahrungen der (post-)modernen Gesellschaft. Genau deshalb wirken sie wie eine Neutralisierungspille gegen die überbordende Komplexität in deinem Kopf oder der Welt da draußen. Und wenn dich das schwarze Loch an einem gewöhnlichen Dienstagnachmittag zu verschlucken droht, dann sind sie oft das Einzige, woran du dich noch klammern kannst.
Zweitens: „Ganz bei dir selbst“ oder „ganz im Moment“ zu sein, kann eine verdammt einsame Angelegenheit sein. Authentizität ist nichts für Feiglinge.
Drittens: Der Tag besteht aus 24 x 602 Sekunden, in die noch mal zig Potenzen verschiedenster, potenziell beschissener Emotionen und Gedanken passen. Und im Gegensatz zu Fußnoten kannst du leider keine einzige davon überspringen. Hehre Ziele? Schön und gut, nur wenn dich besagtes Loch an besagtem Dienstagnachmittag zu verschlucken droht, dann musst du da leider ganz allein durch, zurückgeworfen auf deinen Körper und deinen Geist.
Viertens: Keine Sekunde ist für sich genommen unerträglich.
Fünftens: Das Leben ist ein unendliches Wechselspiel aus Nullen und Einsen. Wie gewonnen, so zerronnen; nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Du kannst die Karotte niemals erreichen – was okay ist, solange du überhaupt noch irgendeine Karotte vor deiner Nase baumeln siehst und sie nicht längst kleingeschnippelt im Stolichnaya® gelandet ist.
David Foster Wallace ist knapp 1,5 Milliarden Sekunden alt geworden. Angesichts seines unfassbar komplexen literarischen Werkes, in dem er nicht zuletzt auch seine eigenen Erfahrungen mit schwerer Depression und Suchtproblemen verarbeitet hat, kann man sich nur ansatzweise ausmalen, wie viele dieser Sekunden sich in Form unendlich vieler Gedanken und Ideen in alle Richtungen pulverisiert haben, während andere sich über die Grenze des Erträglichen hinaus in die Länge gezogen haben dürften. Die Karotte, die ihm Zeit seines Lebens in Form einer abgemilderten Depression vor der Nase gebaumelt hat, hing am Ende leider einfach zu hoch.
Patricia Nitzsche, Sozialwissenschaftlerin aus Berlin, hat eine Schwäche für tl;dr-Formate und Fußnoten. Als ihr Infinite Jest vor ein paar Jahren im Grippefieber in die Hände fiel, konnte sie praktisch dabei zusehen, wie sich lesend Neuronen neu verschalteten; seitdem ist sie dem DFW-Stoff verfallen. Patricia hat leider null Ahnung von Tennis, glaubt aber, dass man von Profisport und Sucht eine Menge über die unausweichliche Sinnlosigkeit unseres postmodernen Daseins lernen kann. Ältere Wortbeiträge von ihr finden sich in agora42.
Maika Hassan-Beik, freie Künstlerin und klinische Kunsttherapeutin, hat die Lektüre von Infinite Jest noch nie, gelegentliches Rauchen noch nicht beenden können und stellt sich Sisyphos als einen glücklichen Menschen vor.
Quellenverzeichnis
Coen, Noel (1998): The Big Lebowski [DVD], London/Los Angeles: Working Title Films Ltd.
[ASUPFTH] Foster Wallace, David (2018): A Supposedly Fun Thing I’ll Never Do Again, in: The David Foster Wallace Reader, 1. Aufl., London: Penguin Books, S. 763-844.
[INFJ] Foster Wallace, David (2006), Infinite Jest, Neuaufl. zum 10. Jubiläum, New York:
[TISWA] Foster Wallace, David (2005): This Is Water, 21.05.2005, https://web.ics.purdue.edu/~drkelly/DFWKenyonAddress2005.pdf, letzter Zugriff: 17.01.2021.
Gilbert, Matthew (2012): The “Infinite Story” Cult Hero behind the 1,079-Page Novel Rides the Hype He Skewered, in: Dave Eggers (Hrsg.), Conversations With David Foster Wallace, 1. Aufl., Jackson: University Press of Mississippi, S. 76-81.
Miller, Laura (2012): The Salon Interview: David Foster Wallace, in: Dave Eggers (Hrsg.), Conversations With David Foster Wallace, 1. Aufl., Jackson: University Press of Mississippi, S. 58-65.
Le Guin, Ursula K. (2019): The Dispossessed, 1. Aufl., London: Orion Publishing Co.